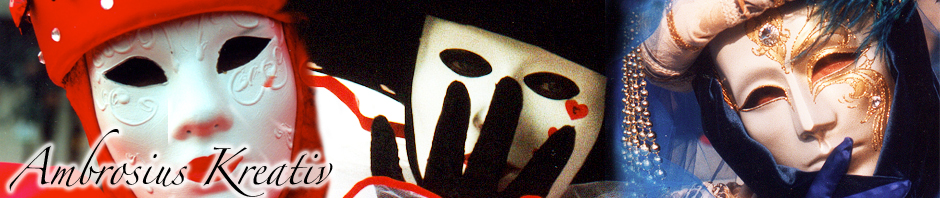Ist Mundart noch „IN“ oder schon wieder „IN“? Wird oder kann man Dialekt überhaupt noch sprechen? In den Firmen unseres „Ländles“, wo wir uns doch alle als „Global Player“ fühlen. Dort ist im Umgang mit Kunden bestimmt angebracht, „schriftdeutsch“ zu kommunizieren! Schon aus dem einen Grund, dass das Gegenüber auch das Gleiche verstanden hat.
Doch im „Privaten“, also in der Kneipe, auf der Gass, auf dem Sportplatz, Kindergarten oder Schule, da kann man seinem schwäbischen Dialekt doch freien Lauf lassen? Und haben uns das die Bayern, die Hessen, die Sachsen, die Norddeutschen, der Berliner nicht schon immer Voraus gehabt? Wir haben uns wegen unseres Dialektes oft geschämt, haben ihn zum „Honorationen-Schwäbisch“ stilisiert. Die anderen haben derweil Ihren Dialekt fleißig gepflegt.
Bei uns gab es in den Siebziger bzw. Achtziger-Jahren auch eine Mundartbewegung. Landauf landab gab es Mundartveranstaltungen mit Mundartautoren und Liedermachern. Das Geld saß noch etwas lockerer als in der heutigen Zeit und so veranstalteten Banken, Gemeinden, Vereine, Winzergenossenschaften regelmäßig Mundartveranstaltungen. Vereine zur Erhaltung der Mundart wurden gegründet und Brauchtumsvereine wieder zum Leben erweckt. Mr war wieder wer! Doch dann verebbte die große Bewegung wieder, einige bekannte Autoren und Liedermacher überlebten und haben sich etabliert.
Auch die Welt hat sich in der Zwischenzeit durch PC und andere Medien verändert. Kommunikation findet über Leitungen, W-LAN und sonstige Verbindungen statt, aber meistens ohne die „Weltsprache Schwäbisch“!
Viele Wörter, Redewendungen, Sprüche und Geschichten versanden, verschwinden, sterben aus. Nur noch die „Alten“ können sich erinnern und pflegen gewisse Traditionen.
Und diese Tradition, die Pflege des schwäbischen Dialektes, möchte ich mit meinen Gedichten, Geschichten, Anekdoten, Sprüchen weiter betreiben. Dies in Worten, in Büchern, im Eigenverlag, dokumentieren, damit dieser Dialekt „der Filder“ nicht verloren geht.
Die schwäbische Sprache ist blumig, wortgewaltig, derb, plump, einfühlsam, schmeichelnd, knitz. Manche Gedichte würden im Schriftdeutschen banal, flach, nichtssagend klingen. Zum Vergessen! Doch im Dialekt wachsen sie zu wahrer Größe, werden zweideutig, hinterlistig, knitz. „S Baierle isch nedd domm, der wois sei Bauraschleie eizomseddsa“!
Ich möchte die Menschen, die täglichen Begebenheiten, die Banalitäten, das Kuriose, das Aufregende, das Verquere portraitieren, entlarfen, ins rechte Licht stellen.
Drom schreib i Schwäbisch denn do falled die Rechdschreibfäälr ed uff ond schwädds wie mr dr Schnabl gwaggsa isch, druggs ed en me nai ond hoff, dass dem oine odr andra des oine odr andre Gedichd odr Gschichd gfälld?
Vielleichd vrziehed se ao a bissle s Gsichd, vielleichd lached se ao so richdig befreiend raus, dass de andre moined Sie hedded an Schbarra?
Viel Schbass ond bis bald.
Claus Ambrosius